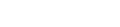University of Zürich
University of Zürich
12/15/2025 | News release | Distributed by Public on 12/15/2025 02:00
«KI verändert die Bildung fundamental»
«KI verändert die Bildung fundamental» | UZH News | UZH
Header
Hauptnavigation
-
Alle News
-
Für Medien
ZurückMenü schliessen
-
UZH Magazin
ZurückMenü schliessen
-
Social Media
ZurückMenü schliessen
-
Mehr
Menü schliessen
15.12.2025 Digitalisierung
«KI verändert die Bildung fundamental»
KI verändert rasant, wie wir arbeiten, lernen und forschen. Das fordert auch die Hochschulen heraus. Der UZH-Think-Tank «FutureU» hat Zukunftsszenarien für die Universitäten im digitalen Zeitalter entwickelt. Medizinerin Claudia Witt und Politologe Karsten Donnay darüber, was Hochschulen künftig leisten müssen und wie sie sich positionieren sollten.
Interview: Thomas Gull und Roger Nickl
Kategorien
Engagieren sich für die Universität der Zukunft: Medizinerin Claudia Witt und Politologe Karsten Donnay im Kollegiengebäude der UZH. (Bild: Stefan Walter)
Claudia Witt, Karsten Donnay, die Digitalisierung - insbesondere durch KI - entwickelt sich mit enormer Geschwindigkeit. Was bedeutet das für die Gesellschaft?
Claudia Witt: Ich habe den Eindruck, dass vieles mit sehr hohem Tempo geschieht, ohne dass wir als Gesellschaft noch bewusst steuern. Wir reagieren auf Entwicklungen, statt aktiv zu gestalten. Es fehlt an Momenten des Innehaltens, in denen wir fragen, ob wir das wirklich wollen und wie wir die neuen Möglichkeiten nutzen. Diese Dynamik spiegelt sich auf vielen Ebenen. Manche Veränderungen durch KI sind sichtbar, etwa in Suchmaschinen oder Software, andere bleiben im Hintergrund. Als Gesellschaft nehmen wir oft nur wahr, was unmittelbar spürbar ist, und verlieren so das Gefühl für den Gesamtzusammenhang.
Karsten Donnay: Das sehen wir auch in aktuellen Umfragen. Die Schweizer Bevölkerung steht der Digitalisierung insgesamt positiv gegenüber. Wenn es aber um KI geht, werden Skepsis und Angst spürbar. Das liegt weniger an der Technologie selbst als am Tempo der Veränderungen und an der mangelnden Transparenz. Wir wissen oft nicht genau, wo KI überall eingesetzt wird, und fühlen uns dadurch verunsichert. Auch die Politik kann kaum Schritt halten. So entsteht der Eindruck, dass wir Entwicklungen hinterherlaufen, statt sie zu gestalten.
Sie beschreiben eine gewisse Überforderung. Welche Rolle spielt dabei die Angst vor Kontrollverlust oder Veränderung?
Donnay: Angst ist ein wichtiger Faktor. Viele Menschen erleben, dass KI plötzlich in Arbeitsprozesse, Informationssysteme oder Alltagstechnologien eindringt. Wenn man nicht versteht, wie das funktioniert, entsteht Unsicherheit. Gleichzeitig geht alles sehr schnell: Wir sehen, dass der Arbeitsmarkt, Informationsquellen und Kommunikationsformen sich in kurzer Zeit verändern. Diese Geschwindigkeit lässt kaum Zeit, sich anzupassen.
Witt: Das gilt auch für Fachbereiche wie die Medizin. Ärztinnen und Ärzte sind plötzlich mit neuen digitalen Tools konfrontiert, die in ihre Arbeitsprozesse eingreifen. Viele erkennen das Potenzial, aber es fehlt oft die Zeit, sich bewusst damit auseinanderzusetzen.
Wie genau verändert KI die Medizin? Wo sehen Sie Chancen - und wo Risiken?
Witt: Am weitesten verbreitet ist der Einsatz in der Bildanalyse - etwa in der Radiologie bei Brustkrebserkennung. Hier zeigen Studien, dass KI in der Auswertung bestimmter Aufnahmen ähnlich gut oder besser ist als Radiologinnen und Radiologen. Gleichzeitig wird KI zunehmend in der Administration eingesetzt, etwa um Berichte zu verfassen, oder in der Dokumentation. Das kann tatsächlich entlasten - vorausgesetzt, die Systeme sind gut integriert und funktionieren verlässlich. Ich betrachte sie als Unterstützungstool. Auch bei automatisch generierten Berichten überprüft am Ende immer eine Ärztin oder ein Arzt die Richtigkeit und unterschreibt. Das ist keine Mensch-oder-Maschine-Frage, sondern Mensch und Maschine arbeiten zusammen.
Herr Donnay, Sie beschäftigen sich mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung von KI. Wo sehen Sie positive Entwicklungen?
Donnay: Viele potenziell positive Effekte von KI sind derzeit noch Versprechen. Man sieht Verbesserungen in alltäglichen Anwendungen - etwa bei der Bildverarbeitung in Smartphones oder bei Übersetzungstools. Aber der tiefere gesellschaftliche Nutzen ist schwer messbar, weil wir uns noch in einer frühen Phase der Integration befinden. Jüngere Menschen sind dabei oft deutlich experimentierfreudiger. Viele nutzen ChatGPT oder ähnliche Tools selbstverständlich. Ältere Generationen oder weniger technikaffine Gruppen sind noch zögerlich. Diese Ungleichheit führt zu einem Auseinanderdriften in der Erfahrung mit KI. Zudem sind auch Unternehmen derzeit in einer Experimentierphase. Es gibt unzählige Tools, aber oft noch keine Gewissheit, welche sich durchsetzen und welche wirklich nützlich sind. Diese Unsicherheit prägt den öffentlichen Diskurs.
Wenn wir KI einfach nutzen, weil sie verfügbar ist, statt sie gezielt zu integrieren, verlieren wir die Souveränität über unser Handeln.
Claudia Witt
Medizinerin
Wie gehen Sie an der Universität Zürich mit dieser Dynamik um?
Donnay: Wir erleben auch hier grosse Unsicherheit. Studierende fragen sich: Was ist erlaubt? Was ist ethisch vertretbar? Unsere Fakultät hat daher klare Richtlinien entwickelt, die Transparenz fördern. Und wir als Institut haben dazu ganz konkrete Empfehlungen für unsere Dozierenden ausgearbeitet. Studierende sollen offenlegen, ob sie KI verwendet haben - etwa für Textkorrekturen oder für die Datenanalysen. Es geht nicht darum, KI zu verbieten, sondern verantwortungsvoll zu nutzen. Wir lehren, wie man diese Tools kritisch einsetzt: Wo helfen sie wirklich? Wo erzeugen sie Probleme? Dabei lernen wir selber mit. Auch die Lehrenden experimentieren - zum Beispiel mit KI bei der Vorbereitung von Lehrmaterial, doch am Ende trägt immer der Mensch die Verantwortung.
Witt: Ich sehe das ähnlich. Wir alle befinden uns in einer Lernphase. Wichtig ist, dass wir Freiräume schaffen, in denen Studierende und Lehrende ausprobieren dürfen, damit Innovation nicht durch zu starre Regeln ausgebremst wird. Gleichzeitig braucht es aber auch ethische Leitplanken, um Qualität und Integrität zu sichern.
Wie ist die Grundhaltung der UZH im Umgang mit KI?
Donnay: Wir verfolgen einen pragmatischen Ansatz. Die Realität ist, dass über 90 Prozent der Studierenden KI bereits verwenden. Ein Verbot wäre weltfremd. Stattdessen schaffen wir Rahmenbedingungen: Wir erklären, was erlaubt ist, was nicht und wie man verantwortungsvoll damit arbeitet. Gleichzeitig sammeln wir Erfahrungen und passen die Regeln laufend an.
Nun hat das Digital Strategy Board der UZH den Think-Tank «FutureU» zur Universität im digitalen Zeitalter initiiert. Sie waren am ersten Positionspapier beteiligt. Im Zentrum steht die Idee, den Umgang mit KI aktiv zu gestalten. Was wollen Sie damit erreichen?
Witt: Mit dem Think-Tank haben wir einen Raum geschaffen, in dem wir bewusst über die Zukunft nachdenken - jenseits des Alltagsbetriebs. Wir wollen nicht nur auf Entwicklungen reagieren, sondern aktiv gestalten. Das Positionspapier ist ein erster Schritt: Es soll Orientierung geben und zeigen, wo die Universität gestalten kann. Wir möchten die Community anregen, sich zu fragen, wie wir in der eher fernen Zukunft Forschung und Lehre gestalten wollen. Dafür nutzen wir Methoden der Zukunftsforschung, um Szenarien zu entwickeln, die fundierte Visionen sind.
Welches sind die Herausforderungen, vor denen Universitäten stehen, und welche Rolle werden sie künftig spielen?
Witt: KI verändert die Bildungslandschaft fundamental. Wissen ist nicht mehr exklusiv. Schon heute kann man vieles online lernen, auch durch kommerzielle Plattformen. In der Zukunft werden vermehrt KI-Tools Lerninhalte generieren. Auch Forschung findet nicht mehr nur an Universitäten statt: Immer mehr Unternehmen betreiben eigene Forschungszentren. Dadurch verschiebt sich die Rolle der Hochschulen.
Donnay: In manchen Bereichen ist die Industrie bereits führend - etwa in der Entwicklung von KI-Technologien. Universitäten haben weniger Ressourcen und kleinere Teams. Unser Vorteil liegt in der wissenschaftlichen Tiefe, in der Reflexion und im kritischen Denken. Wir sichern die Qualität und Glaubwürdigkeit von Wissen. Abschlüsse und Zertifizierungen sind noch immer ein starkes Gütesiegel - aber auch das kann sich verändern, wenn Arbeitsmärkte stärker auf praktische Fähigkeiten setzen.
Was bleibt also der besondere Wert der Universität in Zukunft?
Witt: Zu den Stärken der Universität gehören Interdisziplinarität und die Verbindung von Forschung und Lehre. Wir können komplexe Themen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und inter- und transdisziplinär bearbeiten. Gerade im Zeitalter der KI wird diese Breite wichtiger denn je. Wir lernen durch Forschung und forschen durch Lehre - das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das Unternehmen so nicht haben.
Donnay: Die grossen gesellschaftlichen Fragen lassen sich nur noch inter- und transdisziplinär lösen. An der UZH arbeiten Menschen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammen. Solche Kooperationen sind eine Voraussetzung, um komplexe Phänomene wirklich zu verstehen. Das erfordert nicht nur Wissen, sondern auch die Fähigkeit, die Sprache anderer Disziplinen zu sprechen.
Witt: Deshalb ist es so wichtig, dass wir Strukturen wie die School for Transdisciplinary Studies haben, wo Studierende transdisziplinär lernen und forschen. Sie zeigt, dass wir an der UZH verstanden haben, wie entscheidend fächerübergreifendes Denken für die Zukunft ist. Bleibt man in disziplinären Silos, ist man den künftigen Herausforderungen nicht gewachsen.
Im Positionspapier FutureU haben Sie Szenarien für das Jahr 2050 entwickelt. Wo stehen wir in 25 Jahren?
Witt: Die Welt wird in 25 Jahren kaum wiederzuerkennen sein. Technologie wird allgegenwärtig sein und unseren Zugang zu Wissen grundlegend verändern. Vielleicht sind wir dann direkt mit Informationsquellen vernetzt, unser Denken verschmilzt gewissermassen mit Datenströmen. Gleichzeitig wird Robotik in vielen Lebensbereichen selbstverständlich sein - in Pflege, Industrie oder Forschung. Das wird den Arbeitsmarkt massiv verändern: Viele Routinetätigkeiten werden wegfallen, neue Berufe entstehen. Auch die Forschung selbst wird sich wandeln. Wenn sie zu stark von industriellen Interessen geprägt wird, droht die gesellschaftliche Perspektive zu kurz zu kommen. Universitäten müssen daher Räume erhalten, in denen Forschung betrieben werden kann, ohne dass sie sofort ökonomisch verwertbar sein muss. In der Lehre werden immersive, interaktive Lernumgebungen Alltag sein. Studierende werden mit persönlicher KI-Begleitung- AI-Buddys - arbeiten, die Lernen individuell unterstützen. Unsere Aufgabe wird sein, den kritisch-reflektierten Umgang mit Wissen zu fördern - das bleibt die zentrale Kompetenz der Zukunft.
Die Realität ist, dass über 90 Prozent der Studierenden KI bereits verwenden. Ein Verbot wäre weltfremd.
Karsten Donnay
Politologe
Im Positionspapier sehen Sie die Universität als «Trustworthy Institution», als Vertrauenszentrum für die Gesellschaft. Weshalb spielt Vertrauen für Universitäten eine so grosse Rolle?
Witt: Vertrauen ist die Grundlage jeder wissenschaftlichen Institution. Es entsteht wechselseitig: Eine Institution muss glaubwürdig handeln, und die Gesellschaft muss bereit sein, ihr Vertrauen zu schenken. Historisch galten Universitäten als Orte der Verlässlichkeit und Expertise. Dieses Bild müssen wir im digitalen Zeitalter neu mit Leben füllen. Umfragen zu Digitalisierungsthemen zeigen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in Universitäten nach wie vor hoch ist - deutlich höher als in die Industrie. Das hängt damit zusammen, dass wir nicht gewinnorientiert arbeiten und Vielfalt zulassen. Gerade diese Offenheit, unterschiedliche Perspektiven zu diskutieren, ist ein Element von Vertrauenswürdigkeit.
Donnay: Vertrauen hängt auch mit der Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft zusammen. Wenn Forschung sich zu sehr an wirtschaftlichen Interessen orientiert, geraten die langfristigen Fragen aus dem Blick: Was nützt der Gesellschaft wirklich? Wo entstehen Fehlentwicklungen? Hier kommt die kritische Funktion der Universitäten ins Spiel. Wir sollen nicht nur Wissen produzieren, sondern auch Entwicklungen hinterfragen - und deutlich machen, welche Konsequenzen sie haben können. Diese kritische Distanz bleibt essenziell. Politik und Öffentlichkeit brauchen verlässliche, unabhängige Partner:innen, die Orientierung geben. Universitäten sollten Debatten anstossen, Denkräume öffnen und unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringen.
Wie verändert sich das Verhältnis zu grossen Tech-Konzernen wie Google & Co., die selbst stark in Forschung investieren?
Witt: Die grossen Technologiekonzerne werden ihre Dominanz weiter ausbauen. Sie verfügen über enorme Ressourcen und Datenmengen - das wird sich in den kommenden Jahrzehnten noch verstärken. Deshalb ist es wichtig, dass Universitäten ihre eigenständige Rolle bewahren. Kooperationen sind sinnvoll und oft notwendig, aber sie müssen auf Augenhöhe stattfinden. Die Stärke von Universitäten liegt darin, Themen mit gesellschaftlicher Relevanz zu verfolgen - ohne primär ökonomische Ausrichtung. Wir können uns ergebnisoffene Forschung erlauben. Gleichzeitig brauchen wir den Dialog mit der Wirtschaft, um auch gemeinsam zu gestalten.
Donnay: Zwischen Universität und Industrie besteht ohnehin ein reger Austausch. Forschende wechseln in Unternehmen und zurück - Wissen zirkuliert. Das ist wertvoll, weil so gegenseitiges Lernen entsteht. Wichtig ist zudem, dass Universitäten ihren Bildungsauftrag wahrnehmen. Die meisten unserer Absolventinnen und Absolventen arbeiten später nicht in der Forschung, sondern in vielen verschiedenen Rollen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wenn sie das kritische Denken, den reflektierten Umgang mit Daten und ethische Verantwortung mitnehmen, prägen sie diese Bereiche entsprechend mit. Lehre ist also nicht nur Berufsausbildung, sondern eine Schule des Denkens - und damit ein nachhaltiger Beitrag zur Gesellschaft.
Sie haben die Offenheit der Wissenschaft angesprochen. Was bedeutet das konkret für das Vertrauen?
Witt: Offenheit ist ein zentraler Pfeiler wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit. Open Science bedeutet, Methoden, Daten und Ergebnisse transparent zu machen, so, dass andere Forschende sie prüfen, nachvollziehen und auch für weitere Forschung nutzen können. Open Science macht Forschung überprüfbar und stärkt ihre Qualität. Dies unterscheidet uns von privatwirtschaftlicher Forschung, in der vieles nicht zugänglich ist.
Ist das nicht ein bisschen naiv: die Universität als vertrauenswürdige Institution und als kritische Sparringpartnerin für Wirtschaft und Gesellschaft - das sind liberale Ideale, die lange als selbstverständlich galten. In den USA werden sie zurzeit grundsätzlich in Frage gestellt. Könnte es in Zukunft nicht sein, dass die unabhängige Expertise der Universitäten gar nicht mehr gefragt ist?
Donnay: Dieses Risiko besteht durchaus. In unseren Zukunftsszenarien haben wir auch solche Entwicklungen diskutiert - bis hin zu der Frage, ob Regierungen überhaupt noch unabhängige Forschung fördern wollen. In den USA gibt es diese Tendenzen, kritische Wissenschaft politisch zu marginalisieren. Das zeigt, dass unabhängige, offene Universitäten nicht selbstverständlich sind. Genau deshalb müssen wir aktiv daran arbeiten, dass unsere Rolle anerkannt bleibt - politisch, gesellschaftlich und institutionell. Wir müssen deutlich machen, warum freie Forschung für Demokratie und Fortschritt unverzichtbar ist.
Witt: Es geht dabei nicht um Selbstzweck. Universitäten sind wichtig, weil sie Diversität und Gemeinwohl sichern. Sie geben auch Minderheitenpositionen Raum und ermöglichen gesellschaftliche Selbstreflexion. In der Schweiz ist das Vertrauen in die Hochschulen hoch, und ich bin optimistisch, dass wir diesen Wert bewahren können.
Wie geht es nach dem Positionspapier weiter?
Witt: Der Think-Tank bleibt aktiv. Momentan beschäftigen wir uns vertiefter mit «Trustworthiness» - also Vertrauenswürdigkeit - und danach mit den Kompetenzen, die Forschende und Lehrende in Zukunft brauchen werden. Nächstes Jahr wollen wir erneut in einem Zukunftsworkshop konkrete Szenarien für eine Universität in der digitalen Zukunft erarbeiten.
Donnay: Parallel dazu vernetzen wir diese Arbeit mit anderen Initiativen - etwa der KI-Strategie der UZH. Forschung, Lehre und Digitalisierung müssen zusammengedacht werden. Wir tauschen uns mit anderen Hochschulen aus, sammeln Best Practices und übertragen sie auf unsere Strukturen. Wichtig ist, kurzfristige Massnahmen mit langfristigen Perspektiven zu verbinden. Wir wollen in ein bis zwei Jahren so aufgestellt sein, dass wir technologische Entwicklungen aktiv mitgestalten können - und unsere Studierenden dabei mitnehmen. Denn wenn sie das Gefühl haben, die Universität bleibe hinter der Realität zurück, verlieren wir an Relevanz.
Wie offen ist die Universität selbst für diesen Wandel?
Donnay: Die UZH hat in den letzten Jahren gezeigt, dass kultureller Wandel möglich ist - die Digital Society Initiative mit über 1400 Forschenden ist dafür ein gutes Beispiel. Sie hat bewiesen, dass Kooperation, Offenheit und gemeinsame Ziele die Grundlage sind, um den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten.
Witt: Ich erlebe viel Offenheit dafür, mutig etwas Neues auszuprobieren - und gleichzeitig das kritische Denken zu bewahren. Aus meiner Sicht bleiben wir auch 2050 eine relevante, glaubwürdige Institution, wenn wir unsere Alleinstellungsmerkmale ausbauen und die Zukunft aktiv mitgestalten.
Interview: Thomas Gull und Roger Nickl
FutureU: Universitäten im digitalen Zeitalter
Der Think-Tank «FutureU: Universities in the Digital Age» ist eine der Antworten der UZH auf die Herausforderungen der digitalen Transformation. Er initiiert und unterstützt unter UZH-Angehörigen eine aktive, kritische und vorausschauende Auseinandersetzung mit den vielfältigen Entwicklungen, Chancen und Fragestellungen der digitalen Zukunft. Ein Kernteam entwickelt unterschiedliche Zukunftsszenarien, aus denen sich strategische Handlungsoptionen ableiten lassen.
Projektleitung und Kontakt: [email protected].
UZH.ai: KI erforschen
Forschende der UZH entwickeln künstliche Intelligenz, nutzen sie gezielt in ihrer Forschung und untersuchen ihre Auswirkungen auf Wissenschaft und Gesellschaft. Seit September 2025 vernetzt UZH.ai die KI-Forschenden der Universität Zürich noch enger und fördert den Dialog mit Industrie, Politik und Gesellschaft zum Thema KI.
Projektleitung und Kontakt: [email protected]
Zu den Personen
Prof. Karsten Donnay ist Politologe und leitet den Forschungsbereich politische Verhaltensforschung und digitale Medien am Institut für Politikwissenschaft. In seiner Forschung untersucht er die Auswirkungen der digitalen Transformation auf Politik und Gesellschaft mit einem besonderen Augenmerk auf digitale Onlinemedien. Er ist DSI-Professor und Co-Direktor des Population Research Center der Universität Zürich.
Prof. Claudia Witt ist Medizinerin und Professorin an der Medizinischen Fakultät. Sie forscht zu Themen im Bereich Digital Health. Zudem engagiert sie sich als Co-Direktorin der Digital Society Initiative, ist Mitglied des Digital Strategy Board und Facilitatorin des Think-Tank «FutureU» für die digitale Transformation.
Footer
Universität Zürich
News abonnieren
Kontakt
Weiterführende Links
© 2023 Universität Zürich
Bild Overlay schliessen
Video Overlay schliessen
[%=content%] [%=content%] [%=content%]
[%=text%]
University of Zürich published this content on December 15, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on December 15, 2025 at 08:00 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]